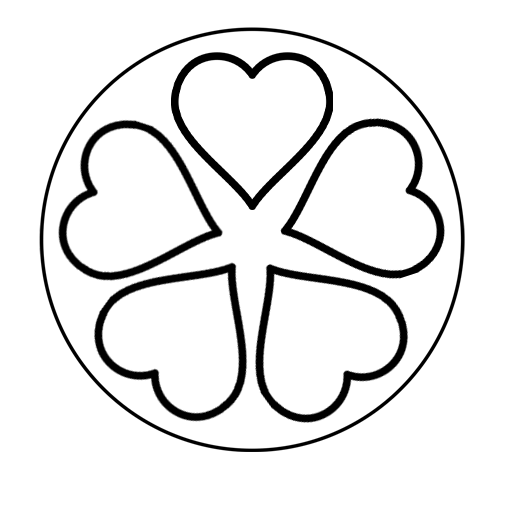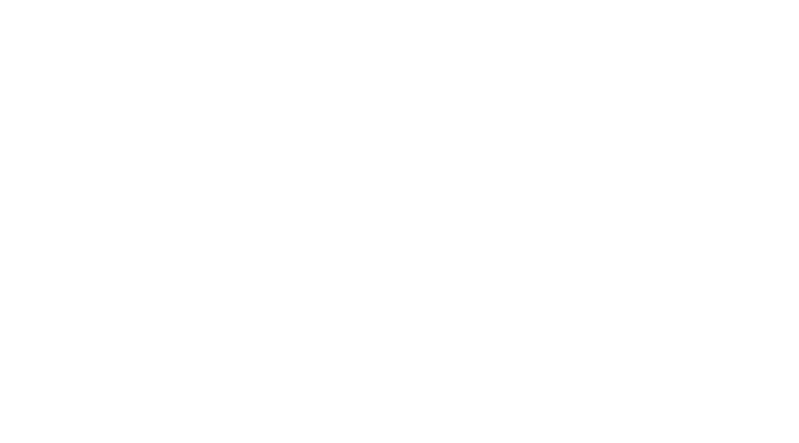
Der Anbau von Heilkräutern in Klostergärten folgte ganz praktischen Erwägungen. Einige typische Vertreter der sogenannten Klosterheilkunde stellen wir hier vor.

Alant
Inula helenium
Hochaufragende Stengel mit sonnengelben Blüten verraten nicht, welche Kräfte in den Wurzeln der Staude stecken. Unbestritten ist seine Rolle in der mittelalterlichen Heilkunde. Jeder kannte und nutzte ihn. Alantwurzeln waren häufig Zutaten für die zu dieser Zeit populären Heilweine. Seine Rolle als Heilmittel gegen Erkrankungen der Brust und Lunge hat er im Laufe der Zeit eingebüsst. Wie es dazu kam, lesen sie in unserem Artikel …

Benediktenkraut
Cnicus benedictus
Dieses kleine distelige Gewächs beeindruckt mit seiner Blüte. Sie ist auch das unverkennbare Erkennungszeichen des Benediktenkrautes. Sein Kraut mitsamt der Stengel und Blüten zählen zu den sogenannten Bitterdrogen. Sie bewirken meist eine verstärkte Sekretion der Verdauungssäfte, was zur Steigerung des Appetits beiträgt, und dyspetische Beschwerden lindert. Eine gute Verdauung war eines der drängendsten medizinischen Themen vom Mittelalter bis hinein in die Neuzeit. Kein Wunder, dass das aus dem Mittelmeerraum stammende Benediktenkraut in den Klostergärten nördlich der Alpen angebaut wurde, wie Sie im Beitrag lesen …

Borretsch
Borago officinalis
Die blauen Blütensterne des Borretsch sind ein toller Schmuck für jedes Kräuterbeet. Dabei spielten die farbigen und schmückenden Aspekte bei der Verwendung von Borretsch niemals eine Rolle. Sein Kraut wird gut und gerne genutzt zum Würzen von Gemüsen, insbesondere Gurken, und für kalte Saucen. Harnverhalt sollen sie lösen können. Vor allem die älteren Klosterbrüder dürften vom Anbau des Borretsch’s im Klostergarten profitiert haben. Alles genau nachlesen …

Eberraute
Artemisia abrotanum
Schön ist die Eberraute nicht. Ihr Duft und das Aroma sind jedoch bemerkenswert. Erstaunen ruft ihr intensives Aroma hervor, was stark an das Süssgetränk Cola erinnert. Ihr Zweitname Cola-Strauch ist ein wenig irreführend. Im benannten Softdrink ist nicht ein Fizzelchen Eberraute oder Colastrauch enthalten. Das hielt jedoch einige Generationen von Klosterbewohnern nicht ab, die Eberraute als würzende Zutat für Liköre und andere alkoholische Getränke zu verwenden. Wieso ihr eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird, gibt bis heute Rätsel auf. Mehr erfahren Sie hier …

Echter Eibisch
Althaea officinalis
Bei erkältungsbedingtem Husten kann der Echte Eibisch (Althaea officinalis) hilfreich sein. Seine schleimbildenden Stoffe fördern die Sekretbildung und das Abhusten. Das wussten im Prinzip schon unsere Urahnen. Ob sie es von Nonnen oder Mönchen erfahren haben, wird wohl nie Thema einer Forschungsarbeit sein. Schön sind seine Blüten und heilkräftig die Blätter und Wurzeln. Jahreszeitlich bedingte Erkrankungen verschonten Klöster auch in der Vergangenheit nicht. Kein Wunder, dass eine gutsortierte Klosterapotheke Eibisch vorrätig haben musste.

Echte Feige
Ficus carica
Der aus dem Mittelmeerraum stammende Baum war stets begehrt wegen seiner süssen Früchte und der seltsamen Gestalt. In nördlichen Gefilden musste man sich einen Feigenbaum leisten können. Entweder der Standort mit viel Sonne und Wärme ermöglichte ein Überwintern. Oder ein eigenes Feigenhaus wurde angeschafft wie im Stift Kremsmünster. Die Früchte gelten gemeinhin als Delikatesse, egal ob trocken oder frisch. Trotz ihrer verdauungsfördernden und stuhlerweichenden Eigenschaften haben sie es nie zur Anerkennung als pflanzliches Heilmittel geschafft. Die Damen und Herren mit Verstopfung dürften ihre Wirkung geschätzt und daher den Anbau in unseren Breitengraden gefördert haben.

Mariendistel
Silybum marianum
Die wohl schönste Distel ist der Jungfrau Maria gewidmet. Ihr Inhaltsstoff Silymarin ist der grosse Hoffnungsträger für die Behandlung einer Zivilisationskrankheit der nichtalkoholischen Fettleber. Lange Zeit davor wurde schon davon ausgegangen, dass die Mariendistel bei Leberbeschwerden vielfältiger Art hilfreich sein kann. Strittig ist nach wie vor, ob sie die Neubildung von Leberzellen anregen kann. Aus diesem Grund wurde ihr auch ein fester Platz in den Klostergärten eingeräumt. Die wertvollen Inhaltsstoffe stecken in den Blütenständen. Ein wertvolles und gesundes Speiseöl ergibt sich aus der Pressung der schwarzen länglichen Früchte.

Melisse
Melissa ofiicinalis
In der Wirkung tonisierend und ausgleichend passt die Melisse perfekt zum Leben und Alltag im Kloster. Wahrscheinlich kann sie zur Grundausstattung eines Klostergartens gerechnet werden. Hildegard von Bingen vertrat die Auffassung, dass das Verspeisen von Melisseblättern das Herz erfreut und die Stimmung verbessert. Damit hatte sie wohl recht. Der Melissengeist einer Kölner Klosterfrau allerdings bestach einst durch seine alkoholische Wirkung. In unveränderter Rezeptur produzieren die Unbeschuhten Karmeliten in der italienischen Provinz ihr beliebtes Aqua di Melissa seit 1710 – eine als Magentropfen getarnte Zutat für sommerliche Erfrischungsgetränke. Hier weiterlesen …

Mönchspfeffer
Vitus agnus-castus
Der Mönchspfeffer war Arzneipflanze des Jahres 2022. Die Früchte des dekorativen Strauches schmecken leicht pfeffrig. Sie stehen unter dem Verdacht, die männliche und auch die weibliche Libido zu besänftigen und wenn nicht sogar ausschalten zu können. Das hat dem Mönchspfeffer die gebräuchliche Bezeichnung Keuschlamm eingebracht. Überwiegend wurden jedoch die kleinen kugeligen Strauchfrüchte zum Würzen von Speisen verwendet. Tatsächlich scheinen Extrakte aus dem Mönchspfeffer eine Wirkung auf den hormonellen Stoffwechsel ausüben zu können. Sie können sich dazu eignen, Menstruationsbeschwerden zu lindern. Lesen Sie hier weiter …

Sr. Hedwig
Missionsschwester vom Kostbaren Blut, Wernsberg
Traditioneller Anbau von Heilpflanzen und Kräutern braucht Liebe und Enthusiasmus
Klosterläden sind kleine Schatzkammern. Literatur, Souvenirs, Devotionalien und in einigen Fällen Kräutertee-Mischungen aus eigenem Anbau. Es sind die reinen und unverfälschten Dinge, die in unserem Alltag kostbar sind. Können und Fleiss sind notwendig bei der Auswahl der Kräuter für einen guten Tee. Schwester Hedwig von den Wernberger Missionsschwestern vom Kostbaren Blut hat uns einige Geheimnisse verraten.

Herzgespann
Leonurus cardiaca
Für das Auflösen nervöser Herzbeschwerden soll das Kraut des Herzgespanns (Loeonurus cardiaca) pflanzliche Wirkstoffe enthalten. Kaum vorstellbar, dass dieses Kraut im Kloster benötigt wird. Ein Leben in Stille und Gebet klingt zunächst nach Ausgeglichenheit. Selbst Nonnen und Mönche sind vor Sorgen und Ängsten nicht gefeit. Sicherlich gibt es auch Momente in einem Klosterleben, wenn das Herz unruhig wird und schneller schlägt. Tees und Tinkturen aus dem Kraut des Herzgespanns sind brauchbare Helfer und haben schon oft gute Dienste geleistet.

Kapuzinerkresse
Tropaeolum majus
Von den Senfölglykosiden haben die Klostergärtner vor Generationen noch nichts gewusst. Auch war ihnen die antibiotische Wirkung unbekannt. Der Anbau von der bunten Kapuzinerkresse diente lediglich der Befriedigung kulinarischer Interessen und als Gartenschmuck. Kapuzinerkresse ist nicht in unseren Breiten beheimatet. Sie kam aus Süd- und Mittelamerika zu uns, allerdings ohne die Beteiligung von Kapuzinern.

Raute
Ruta graveolens
Bereits seit dem Mittelalter soll die Weinraute (Ruta graveolens) in den Klostergärten nördlich der Alpen angebaut worden sein. Zum Würzen von Speisen waren ihre aromatischen Blätter begehrt. Sie galt als Gewürz der römischen Küche. Wie das meiste aus dem Garten wirkt die Wein-Raute diuretisch. Andere sagen, sie wirkt harntreibend. Sie wurde wohl auch als Abortivum genutzt. Hingegen sollen sich mit ihr auch Durchfälle lindern lassen. Hildegard von Bingen empfahl sie bei Melancholie und Ejakulationsstörungen. Für letzteres hatte sie ein Rezept bei dem die Raute zusammen mit Wermut in Wein angerührt wird. Den gesamten Artikel lesen …

Rosen
Rosa
Rosen gehören zum unverzichtbaren Inventar eines jeden Klostergartens. Als Sinnbild der Jungfrau Maria sind sie neben ihres beeindruckenden Blütenschmucks und Duftes ein zutiefst kontemplatives Element in der klösterlichen Gartengestaltung. Das spiegelt sich häufig in den Bepflanzungen der Gärten der Kreuzgänge wieder, wo Rosen nicht fehlen dürfen. Als Heilpflanze wird sie nur selten angebaut, wobei die Blütenblätter der Damaszener-Rosen, der Essig-Rose und Rosa centifolia über heilende Kräfte verfügen. Mehr erfahren Sie hier …

Quitten
Cydonia oblonga
Nördlich der Alpen und südlich des Mains war das Klima günstig für den Anbau der Quittenbäumchen in den Klostergärten. Sie lieferten mit ihren Früchten nicht nur knallhartes Obst, sondern auch Grundstoffe für eine gesundheitsfördernde Ernährung. Lesen Sie hier mehr …

Schlaf-Mohn
Papaver somniferum
Der getrocknete Saft aus den angeritzten Fruchtkapseln des Schlaf-Mohns enthält den Rohstoff fürs Opium. Der Anbau von Schlaf-Mohn in Klostergärten bediente nicht den beabsichtigten Drogenabusus. Aus Ermangelung wirksamer Schmerz- und Narkosemittel zur damaligen Zeit griff man auf die bekannte Wirkung des Schlafmohns zurück. Oftmals war es die einzige Option für eine adäquate Schmerzbehandlung. Für die Klosterapotheke war der Klostergarten einer der wichtigsten Lieferanten in einer geschlossenen Lieferkette.

Ysop
Hyssopus officinalis
Eine wahrhaft biblische Pflanze ist der Ysop. Kein Wunder, dass er allein zur Erbauung in Klostergärten angebaut und kultiviert wurde. Bereits das Alte Testament ist des Lobes voll, wenn es um den Ysop geht. Die Meinungen zu seinen heilenden Kräften gehen weit auseinander. Sicher ist, dass sein Aroma stets als Wohlgeruch wahrgenommen wird. In der Aromatherapie sind seine positive Gefühle auslösende Wirkungen bekannt. Überaus geschätzt werden Aromen des Ysops in allen Klöstern, die sich mit der Herstellung hochprozentiger alkoholischer Getränke beschäftigen, wie die Kartäusermönche der La Grand Chartreuse mit ihrem gleichnamigen Likör. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel …