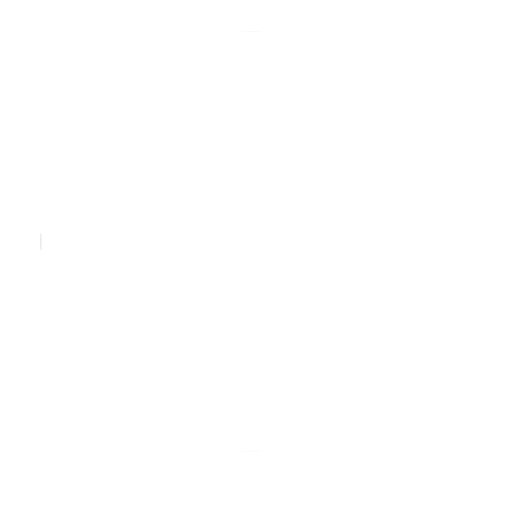Ordensgemeinschaften und ihre Gärten
Die unterschiedlichen Ausrichtungen in Spiritualität und im Zusammenleben der verschiedenen monastischen Orden finden Ausdruck in der Architektur und der Gestaltung und Anlage ihrer Gärten. Der Lauf der Zeit, die Landschaft, die klimatischen Bedingungen haben Stilrichtungen, Geschmack und Gestaltungswillen der Gärtnerinnen und Gärtner beeinflusst. Voller Ehrfurcht und Bewunderung schauen wir auf die gärtnerischen Werke, die oftmals auch ein Gebet sind. Der Anbau von Heilkräutern und Heilpflanzen in Klostergärten hatte seit Anbeginn Tradition, die auf einer Notwendigkeit der Selbstversorgung basierte. Später wuchs sich das als Wirtschaftsfaktor aus, der im Laufe der Geschichte vom pharmazeutischen Gewerbe verdrängt wurde.
Nachdem die Klostergärten im Laufe der Geschichte ihre Bedeutung als Zulieferer der Klosterapotheke oder als Prunkgarten einbüssten, verlor auch die gärtnerische Hinwendung an Intensität. Lange Zeit nach ihrer Blüte waren die Klostergärten oftmals reine Nutzgärten für den Obstbau oder Plätze zum Trocknen der Wäsche. Die Prunkgärten wurden aufgrund ihrer aufwändigen Pflege und ihres teuren Erhalts durch Ziergärten ersetzt. Vielfach konzentrierte sich das Vorhandensein eines Gartens auf die Gestaltung des innenliegenden Kreuzgangs. Gesellschaftliche Umwälzungen im Laufe der Geschichte führten immer wieder zur Auflösung und Aufhebung von Klöstern. Ihre Gebäude und Anlagen wurden einer neuen Nutzung zugeführt oder verkamen schlichtweg.
In den letzten Jahrzehnten nimmt das Interesse an Klostergärten ständig zu. Einerseits spiegelt das die Suche nach Spiritualität in einer zutiefst säkularisierten Zeit und zugleich die Wahrnehmung eines realen Verlusts naturgebundenen Raumes wieder. Eine Entsprechung dieser tief empfundenen Sehnsucht nach Alternativen bieten die vielen Gärten der monastischen Gemeinschaften.