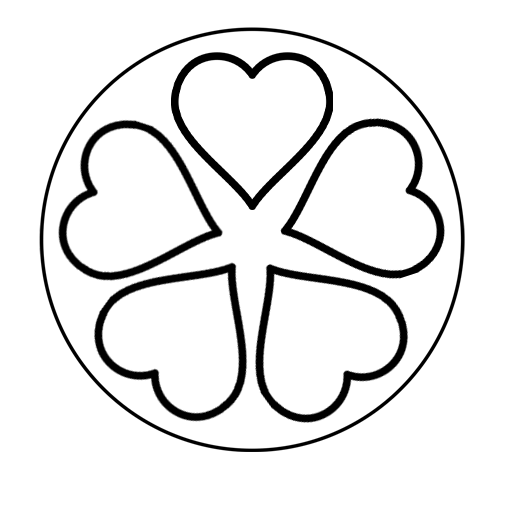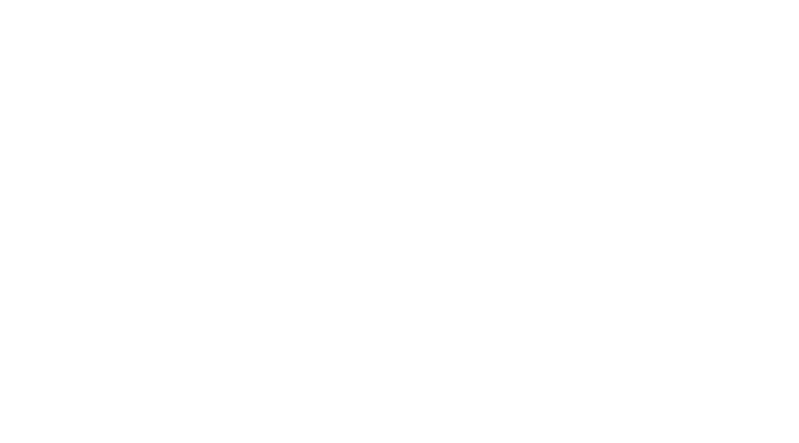Hyssopus officinalis
Die Hypothese, dass es sich beim im Alten Testament erwähnten Ysop nicht um das uns bekannte Hyssopus officinalis handeln könne, fand relativ unkommentiert Eingang in die wissenschaftliche Literatur, obwohl sie logische Fehler aufweist.
Ein Kraut mit Geschichte
Das verblüffende Phänomen, dass Ysop eine Pflanze des Mittelmeerraumes ist aber nicht im Gebiet Palästinas beheimatet, begründet nicht seine völlige Abwesenheit. Im Zuge von Ackerbau und Viehzucht ist Gartenbau üblich und die Anzucht von Kulturpflanzen nichts Ungewöhnliches. Dementsprechend könnte in den Schriften sehr wohl Ysop, wie wir ihn kennen, gemeint sein, obwohl er in freier Natur nicht wuchs.
Die Bücher der Bibel entstammen verschiedenen Verfassern, unterschiedlicher Epochen und beschreiben Geschehnisse an verschiedenen Orten. Nicht erst mit den Übersetzungen der Bibel entstand das Bedürfnis einer Harmonisierung, besseren Verständlichkeit und tieferen Wahrheit. Davon zeugen nicht nur die zahlreichen Überarbeitungen der Einheitsbibel, sondern auch die Vielzahl der unterschiedlichen Interpretationen bei der Deutung einzelner Worte und Passagen. Einen klaren geografischen Bezug hat die erste Nennung von Ysop in der alten Schrift: Ägypten. „Dann nehmt einen Ysopzweig, taucht ihn in die Schüssel mit Blut, und streicht etwas von dem Blut in der Schüssel an den Türsturz und an die beiden Türpfosten.“ Exodus 2. Moses 12,22; Diese Aufforderung Moses’ erging an die Israeliten in Ägypten vor ihrem Auszug ins Gelobte Land, wo kein Ysop wächst. Diese Türmarkierung sollte dem Herrn zeigen, wo die Seinen wohnen, wenn er die Ägypter mit Unheil schlug. Noch wohnten sie in Häusern und verfügten über Gärten, in denen das blaublühende Kraut als Gewürzkraut hätte wachsen können. Auch wenn die medizinischen Schriften der alten Ägypter keinen Hinweis auf den Ysop geben.1
Symbolpflanze der Reinigung
Die Reinigungsriten aus dem Buch Levitikus 3. Moses 14,4.6.51.52; wurden offenbar auf dem Sinai, wo Ysop rar ist, initiiert. Das Volk Israel befand sich nach dem Exodus auf dem Weg ins Gelobte Land. Dabei könnte sich der Mangel an Ysop bereits angedeutet haben, was vielleicht auch mit der Verwendung der Umschreibung als ‚Heiliges Kraut‘ erklärbar wäre.2 Wie so oft erlässt Gott Vorschriften und erwartet das Erfüllen: Mensch, lass Dir was einfallen! Besorg es! Wenn es sich dann nicht in der geforderten Form realisieren lässt, waren schon immer Alternativen gefragt. Ein Weile ging das dann meistens gut, bis die Übertretungen überhand nahmen, und der göttliche Zorn sich entlud. Im Falle vom Ysop wird derartiges nicht berichtet.
Ysop abgeleitet aus dem Griechischen ‚hysopos‘ ist ein Lehnwort semitischer Herkunft (hebr. אֵזוֹב, esov). Es bedeutet duftendes bzw. ‚heiliges Kraut‘. Das hebräische Wort Ezob wird vornehmlich mit dem Syrischen Oregano (Origanum smyrnaeum L.) gleichgesetzt, auch wenn es mit ‚Ysop‘ übersetzt wird. Das besagen die Ausführungen Aron Sandlers im Jüdischen Lexikon (Berlin 1927).3 In Ermangelung ihrer Verfügbarkeit haben Menschen schon immer Zutaten wie Gewürze, Pflanzen und Stoffe ausgetauscht und ersetzt. Meist folgen sie dabei pragmatischen Ansätzen. Exotische Gewürze wurden mitunter durch einheimischen Pflanzen ausgetauscht. In Hungersnöten wurden Wildpflanzen als Gemüse verspeist. Zum Palmsonntag sind es kleine Buchsbaumsträusschen, mit denen der Einzug nach Jerusalem gedacht wird. Es ist nichts Ungewöhnliches und keine Erfindung der Neuzeit, dass Traditionen und Bräuche abgewandelt werden, damit sie anwendbar und ausgeführt werden können. Daher ist es durchaus vorstellbar und logisch, dass die Israeliten verfügbare Wildpflanzen nutzten – in diesem Falle das blühende und duftende Kraut des Syrischen Oregano (Origanum smyrnaeum L.).
Die Zutatenlisten für die Reinigungsrituale waren sehr speziell. Neben Ysop war Karmesin, ein roter Farbstoff aus Läusen, eines der erforderlichen Beiwerke für die Opferrituale. Dabei gilt es zu berücksichtigen dass es sich nicht nur um formelle rituelle Vorschriften handelte, sondern in erster Linie um hygienische Massnahmen. Die von Moses verkündeten Anweisungen regelten den Umgang mit Aussätzigen, Toten und Leichenteilen. Das waren Hygienevorschriften zum Schutz der Gemeinschaft Numeri 4. Moes 19,6.18;. Dementsprechend wäre es nicht verwunderlich, wenn die Israeliten aus Ermangelung auf Pflanzen mit vergleichbaren Eigenschaften wie denen des Ysop (Hyssopus officinalis) zurückgriffen.
Was für die Bücher Moses möglicherweise eine Berechtigung hat, muss für die Psalmen nicht unbedingt gelten. Der Psalm 51 wird König David zugeschrieben. Er bittet darin Gott um Vergebung für zwei folgenschwere Übertretungen, 2. Samuel 11. Sein Flehen und seine tiefe Verzweiflung gipfeln im berühmten Ausruf: „Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich, dann werde ich weisser als Schnee.“
Kloster Hysop ist ein gemein Gartenkraut
/ wie die Salbey / auf holz geartet / auß eyner harten wurzel ein stamm / etwan zwe / drey / demnach der stock alt wurt / gewinet viel zweig wie gerten oder ruten / die von unden an biß oben auß mit schoenen grunen blaettlin bekleidet seind / in aller form wie der Lafander und Spick / die blatlin am Hysop seind aber gruner / breiter / kurzer und zarter / bringet sein blum gegen dem Hewmonatey
Hieronymus Bock

Rätselhaftes Kraut der Bibel
Ob nun König David in seinem Gebet den Syrischen Oregano oder tatsächlich Ysop meinte, lässt sich wahrscheinlich niemals klären. Standesgemäss hatte König David einen Palast in Jerusalem, vermutlich mit Gärten die ausgefallene Blumen und Pflanzen schmückten. Er besass Zugang zu anderen Ländern, Kulturen und Waren aus fernen Gegenden. Die Häfen rings ums Mittelmeer waren durch Handel miteinander verbunden. Ysop war zu dieser Zeit schon im alten Rom eine begehrte Gewürz- und Duftpflanze. Rom exportierte einfach alles: Politik, Kultur, Textilien und Lebensmittel. Vielleicht kam auf diesem Wege Ysop ins Land, wo keiner wächst. Das ist aber reine Spekulation.
Sicherlich hätte König Salomon, sein Sohn, uns Auskunft darüber geben können, welche Pflanze in der Bibel als Ysop benannt wird. Im Lob seiner Weisheit berichtet das 1. Buch der Könige 5,13; dass er sich sehr wohl damit auskannte. „Er redete über die Bäume, von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der an der Mauer wächst.“ Chronologisch ist das die letzte Erwähnung des Ysops im Alten Testament. Erst im Neuen Testament taucht er wieder auf. Der Evangelist Johannes 19,29; wusste von Jesus‘ Martyrium zu berichten, dass ihm, bevor er verstarb, ein Schwamm mit Essig an einem Ysopzweig gereicht wurde. Markus und Matthäus sprachen lediglich von einem Stock. Lukas, obwohl Arzt, wusste davon nichts. Kritiker bemängeln, dass bei einer Wuchshöhe des Ysops (Hyssopus officinalis) von rund 60 Zentimetern, der Zweig niemals an Jesus Lippen hätte reichen können. Wieso die Nennung des Ysopzweigs dem Johannes wichtig war, ist und bleibt uns ein Rätsel.

Hildegard von Bingen
„Ysop ist von trockener Natur und gemäßigt warm und von so großer Wirkkraft, dass ihm nicht einmal ein Felsblock widerstehen kann.“
Hildegard vertrat die Ansicht, dass Husten durch Beschwerden in der Leber verursacht wird. Daher solle Ysop mit Fleischspeisen verzehrt werden.4
Champion der Klostergärten
Allein der Kultivierung in den Klostergärten verdanken wir die Anwesenheit des Ysops (Hyssopus officinalis) in unseren Breiten. Er ist ein Kind der Sonne, braucht die gärtnerische Pflege und wildert daher selten aus. Bis zu seiner Blüte ist er eine recht unspektakuläre Pflanze und kann durchaus mit dem Bergbohnenkraut (Satureja montana L.) verwechselt werden. Blüht er auf, dann gibt es kein Halten für Schmetterlinge, Hummeln, Bienen und andere Insekten. Er ist eine wahrhaftige Bienenweide, die zum meditativen Schauen einlädt. Das frische charakteristisch frische Aroma enthüllt er erst beim Reiben der Blätter und Blüten.
Die in ihrer Verschwiegenheit legendären Kartäusermönche der La Grande Chartreuse halten die Rezeptur und die Kräuter ihres berühmten Kräuterlikörs streng geheim. Feinschmecker identifizieren jedoch die geschmackliche Note des Ysops (Hyssopus officinalis). Sie wird als ein leichtes frisches, süsslich-würziges Aroma beschrieben. Seine Wirkung ist beruhigend und zugleich stärkend. Für die im Mittelalter populären Heilweine war Ysop (Hyssopus officinalis) – zusammen mit Schafgarbe und Nelkenwurz – häufig eine beliebte Zutat. Hildegard von Bingen empfahl ihn sogar roh in Wein eingelegt zu verzehren. Bereits seit dem Altertum galt der Ysop (Hyssopus officinalis) als Heilpflanze gegen Husten und Lungenleiden.
„Mit Wein getrunken, entspannt er Herz und Brust, wenn sie belastet und beklommen sind; …“
Macer Floridus

Geheimtipp für Geniesser
Die frischen Zweige können sofort verarbeitet werden. Alkoholischen Lösungen geben sie ihre grüne Farbe. Der „Grünen Fee“ dem gefürchteten Absinthgetränk des 19. Jahrhunderts verlieh er seine unverkennbar grüne Färbung. Nicht alles muss sich gleich in Alkohol auflösen. Die Zweige mit ihren dunkelgrünen Blätttern und den dunkelblauen Blüten lassen sich auch ganz leicht trocknen. Länger als drei Tage brauchen sie dazu nicht. An einem warmen Ort kopfüber luftig aufgehängt kommt es nicht zur gefürchteten Staunässe. Somit dürfte Ysop das ganze Jahr über verfügbar sein. So oder ähnlich handhabten es bereits die Nonnen und Mönche für die Vorräte ihrer Klosterapotheken.
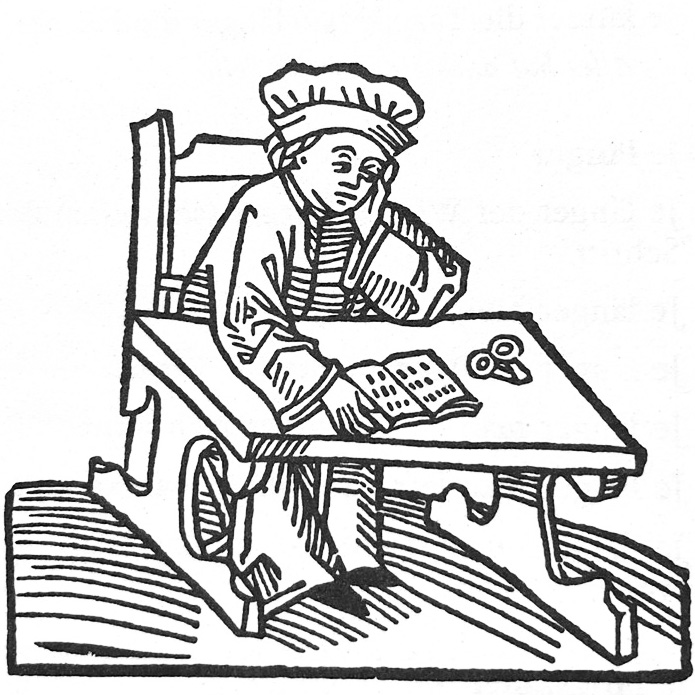
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
Apfelsäure, ätherisches Öl, Cholin, Diosmin, Gerbstoffe, Gummi, Harz, Hesperidin, Hyssopin
Wirkung:
verdauungsfördernd, appetitanregend, antibakteriell, entzündungshemmend, tonisierend
Standort:
lockerer kalkhaltiger Boden, an einem sonnigen und luftigen Standort
Quellen:
- Zorn, B. N.; Wirkung und Anwendung von Hyssopus officinalis L. – eine medizinhistorische Studie, Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg, 2012. ↩︎
- Graz, A.; Hildegard von Bingens ‚Physica‘ – Untersuchungen zu den mutmaßlichen Quellen am Beispiel der Heilanwendungen exotischer und ausgewählter heimischer Gewürzpflanzen, Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg, 2019. ↩︎
- Guski, C.; Pflanze der Reinheit, Jüdische Allgemeine, Berlin, 30.03.2015. ↩︎
- von Bingen, Hildegard; Physica Heilsame Schöpfung – die natürliche Heilkraft der Dinge; Beuroner Kunstverlag 2012. ↩︎
Die Bibel Einheitsübersetzung; Herder Verlag Freiburg, 2009.
Graz, A.; Hildegard von Bingens ‚Physica‘ – Untersuchungen zu den mutmaßlichen Quellen am Beispiel der Heilanwendungen exotischer und ausgewählter heimischer Gewürzpflanzen, Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg, 2019.
Mayer, J. G., Goehl, K.; Kräuterbuch der Klostermedizin der ‚Macer Floridus‘, Nikol Verlag Hamburg, 2021.
Thévenin, T.; Perraudeau, C.; Jousson, J.; Le Chemin des Herbes, Les Éditions Ulmer, Paris 2019.
von Bingen, Hildegard; Causae et Curae – Ursprung und Behandlung der Krankheiten, Beuroner Kunstverlag 2016.
Zorn, B. N.; Wirkung und Anwendung von Hyssopus officinalis L. – eine medizinhistorische Studie, Institut für Geschichte der Medizin der Universität Würzburg, 2012.