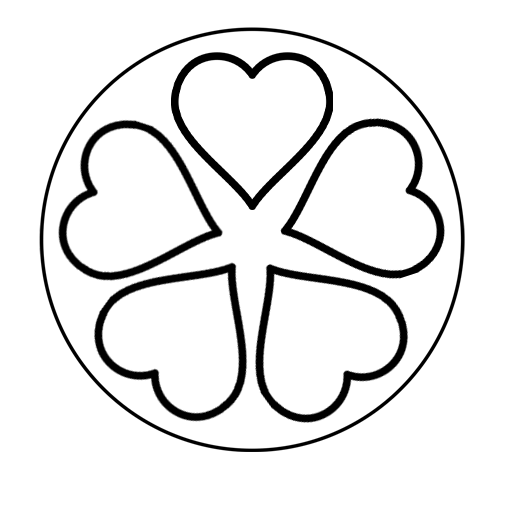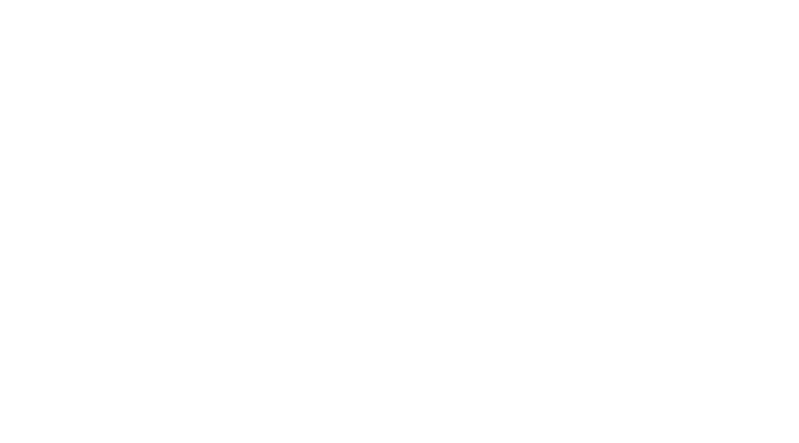Melissa officinalis
Die wahrscheinlich stärkste Marktkapitalisierung der zierlichen Heilpflanze Melisse (Melissa officinalis) gelang einer ehemaligen Ordensschwester vor rund zweihundert Jahren in der Domstadt Köln. Es war hauptsächlich die Wirkung der ätherischen Öle aus den Melissenblättern, mit der sie ihre Kundschaft begeistern konnte. Der Erfolg gab ihr Recht. So konnte sie eine Unternehmung gründen, deren Name auf ihre ursprüngliche Berufung verweist: Klosterfrau.
"Die schweren Träum bey Nacht
und die Melancholey
Melissen stillt
man sagt
daß sie sehr nützlich sey."
Medizinalischer Parnass, 1662

Mit Alkohol zum Erfolg
Der Geist der Melisse entwickelte sich über die Jahrzehnte zum Synonym für weibliche Tiefenentspannung. Gegen Nervosität, Wetterfühligkeit, Magenschmerzen, innere Unruhe und Anspannungen solle die Einnahme von Melissengeist helfen. So wurde er jedenfalls relativ konstant angepriesen. Gestresst vom Druck ihrer Rollenerfüllung waren Frauen bereits schon vor dem 19. Jahrhundert. Wen wundert es, wenn die kleinen hilfreiche Fläschchen Heilwasser mehr oder minder versteckt in den Küchenschränken zahlreicher Haushalte landeten? Melissen- und Karmelitenwässer waren zu dieser Zeit nicht unbekannt. Die Herstellungsverfahren waren etabliert. Dem Geist der Melisse – es handelt sich um die ätherischen Öle der Melissenblätter – wird man durch Destillation und anschliessendes Lösen in hochprozentigem Alkohol habhaft. Auf anschliessendes Verdünnen verzichtete die fleissige Klosterfrau und ihre Nachfolgerinnen. Mit immerhin 79 Volumenprozent ging er in den Verkauf.
Tropfen für den Hausfrieden
Gut gelaunte Hausfrauen sollten ihre Ehemänner begrüssen, wenn sie nach schwerer Arbeit abends nach Hause kamen. Das konservative Frauenbild der Fünfziger Jahre in der Bundesrepublik drängte Frauen zurück in den Haushalt. Alles Schwere solle auf den Schultern der Männer und besser der Ehemänner liegen. Frauen hingegen hätten sich um die leichteren Dinge und die Kinder zu kümmern. Dass die Dinge mit Melissengeist noch leichter würden, und sie noch besser ihrem Rollenbild entsprechen könnten, suggerierte ihnen die Werbung von Klosterfrau. Irgendwie muss es ja auch gestimmt haben. Erst in den Neunzigern des letzten Jahrhunderts wurden kritische Stimmen laut. Sie brachten den domestizierten Alkoholismus im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Melissengeist zur Sprache. Die beschwipste Oma und die fröhlich überdrehte Tante aus den Kindheitstagen wurden plötzlich mit anderen Augen erinnert. Mutterns abendlicher Ausflug zum Eckschrank in der Küche bekam eine andere Bedeutung. An der Zusammensetzung des berühmten Kölner Melissengeistes hat sich nichts geändert. Lediglich auf die Gefahren des Alkoholgehalts wird im Beipackzettel hingewiesen.
Wasser statt Geist
Weit weniger erfolgreich waren die Unbeschuhten Karmeliter in Paris. Bereits 1611 entwickelten sie die Rezeptur für ein Verdauungsmittel namens Melissa Alcoholate, das auf neun Gewürzen und vierzehn Pflanzen basierte, darunter Melissa officinalis. Ihre Rezeptur wurde vielfach kopiert und überliefert. Das Geschäft machten an ihrer statt die italienischen Brüder in Venezien mit dem l’Acqua di Melissa dei Carmelitani. Trotz eines ebenfalls hohen Alkoholgehaltes bestanden sie auf die Bezeichnung Wasser statt Geist. Obwohl es bis heute in unveränderter Form produziert wird, konnten sie nie an die Erfolge der ehemaligen Ordensfrau in Köln anknüpfen. Dabei wachsen die Pflanzen mit den zartgrünen Blättchen, die leicht zitronig duften direkt vor ihrer Haustür. Die Zitronenmelisse, wie sie auch oft genannt wird, stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Wegen ihrer vielseitigen und vor allem zuverlässigen Anwendbarkeit, gehörte sie wohl schon immer zur Grundausstattung der Klostergärten. Wo auch immer Klöster gegründet und Gärten angelegt wurden, soweit es die Witterung zuliess, war der Zitronenmelisse (Melissa officinalis) ein Platz zugedacht.

Hildegard von Bingen
„Melisse ist warm, und der Mensch, der sie isst, lacht gern, da ihre Wärme die Milz berührt und dadurch das Herz erfreut wird.“
Allein das Dasein als Nonne oder Mönch schützen vor innerer Unruhe und Nervosität nicht. Mit Kraft von Gebeten sollte das eigentlich gelingen. Letztendlich sind wir alle nur Menschen. Weshalb sollten wir die Geschenke der Natur nicht nutzen? Auch bei Schlaflosigkeit kann Melisse (Melissa officinalis) hilfreich sein. Das Wunderbare an ihr ist, sie ist einerseits erfrischen und belebend, andererseits wirkt sie ausgleichend und tonisierend. Sie spendet Lebenskraft.
Gärtnerinnen zur Freude
Wenn sie wächst, dann wächst sie. Sie kann Wuchshöhen bis zu 80 Zentimetern erreichen. Das zeigt sie auch ganz beeindruckend in Form einer Melissenhecke im Klostergarten der Abbaye de Mondaye. Die Melisse (Melissa officinalis) ist ein kleines Sensibelchen. Sie bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit frischen Böden, die nicht zu trocken sein sollten. Stauende Nässe hingegen mag sie nicht. Ihre zarten behaarten Blättchen können immer gepflückt und als Gewürz oder zu Heilzwecken verwendet werden. Sie müssen nicht unbedingt getrocknet oder anderweitig verarbeitet werden. Das Trocknen von Melissenblättern erfordert Fleiss und Geduld. Mit trockener und warmer Luft gelingt die Trocknung in zwei Tagen. Dabei verlieren sie reichlich Wasser. Um 100 Gramm getrocknete Blätter zu gewinnen, werden rund 500 Gramm frische Blätter benötigt.
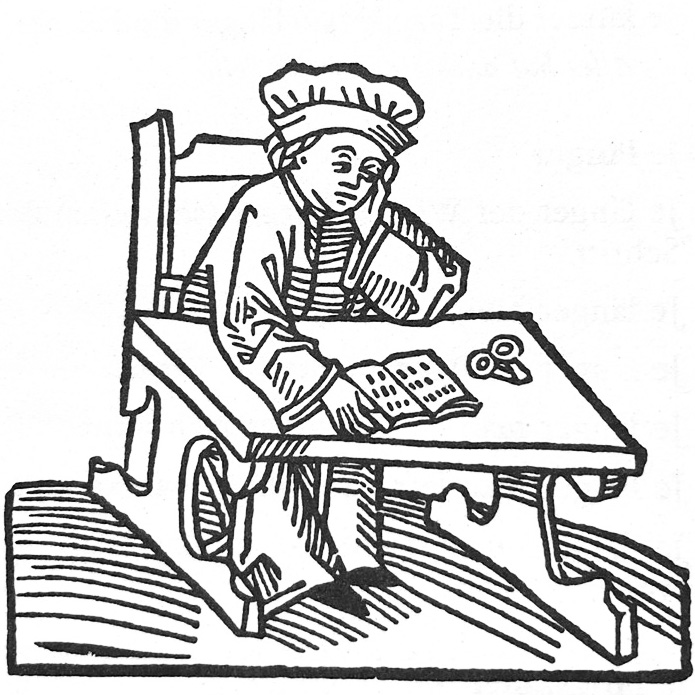
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Gerbsäure, Glykosid, Saponin, Thymol
Wirkung:
tonisierend, entspannend, krampflösend, virenhemmend
Standort:
feuchte Böden an halbschattigen bis sonnigen Standorten
Quellen:
Thévenin, T., Perraudeau, C., Jousson, J.; Le Chemin des Herbes, Les edition Ulmer, Paris, 2019.
Marzeller, H.; Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen, Reichl Verlag St. Goar, 2002.
von Bingen, H.; Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge ‚Physica‘; übersetzt von Ortrun Riha, Beuroner Kunstverlag, 2012.
Zampieri, M.; La Farmacia nel Chiostro, Abbazia di Praglia, 2018.
https://www.apotheken-umschau.de/medikamente/beipackzettel/klosterfrau-melissengeist-580428.html; gelesen 08.09.2025
https://www.klosterfrau.de; gelesen 08.09.2025