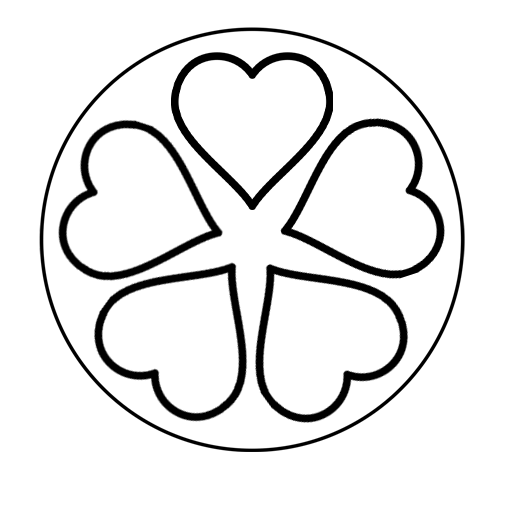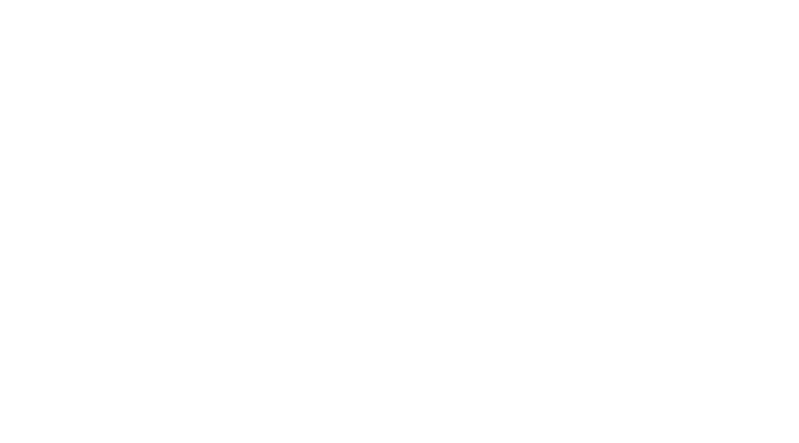Artemisia vulgaris
Dass der Beifuss (Artemisia vulgaris) in den Klostergärten angebaut wurde, scheint zweifelhaft. Er ist an fast jedem Feldrain als Unkraut oder eben als Beikraut präsent. Sein Bedarf liess sich wohl wesentlich leichter mit Wildsammlungen decken als durch mühselige Gartenarbeit. Wesentlich interessanter und wirtschaftlicher dürfte der Anbau seiner Geschwister aus der Gattung der Artemisa gewesen sein: Wermut (Artemisia absinthium) und Eberraute (Artemisia abrotanum). Als Heilkraut war er wichtig und recht bedeutend.
„Der Beifuss stellt uns so recht das Bild einer entthronten Macht dar.“
Heinrich Marzeller

Vielfach beschrieben ist die abortive Wirkung des Beifusskrautes (Artemisia vulgaris). Es fand Verwendung für allerlei Frauenleiden. Insbesondere bei ausbleibenden Regelblutungen war es oft das Mittel der ersten Wahl. Im ‚Gart der Gesundheit‘ findet sich auch die Erwähnung als Mittel zur Geburtseinleitung. Daher wurde der Beifuss (Artemisia vulgaris) wohl auch als ‚Mutter aller Kräuter‘ bezeichnet – zumindest im Kräuterbuch des Odo Magdunensis. Wenn auch die gynäkologischen Indikationen gegen die Verwendung des Krauts innerhalb der Klostermauern – zumindest bei den Männerklöstern – sprechen. Dass das Kraut des Beifuss (Artemisia vulgaris) zum Vorrat einer Klosterapotheke zählte, dürfte dennoch logisch begründet sein. Die Versorgung von Frauen mit gynäkologischen Problemen oblag traditionell kundigen Frauen. Wie vielfach berichtet, war deren Ruf, Leben und Gesundheit stets gefährdet. Allein ein Fehlgriff, Missgunst oder einfach Unverständnis der Materie reichten in vielen Fällen aus, sie in Verruf und um ihre persönliche Integrität zu bringen. Der Bezug von Kräutern und Drogen aus einer Klosterapotheke könnte ihnen zumindest als sichere Bezugsquelle gedient haben, um sich vor dem Verruf verhexter Kräuter zu schützen. Wie sehr Klosterapotheken das Leben der Bevölkerung beeinflussten, erfahren Sie im Beitrag über die berühmte Abbazia di Praglia.

Hildegard von Bingen
„Beifuß ist sehr heiß und sein Saft ist sehr nützlich.“
Zur Linderung von Magen- und Darmverstimmungen aufgrund verdorbener Speisen, sowie gegen Verdauungsbeschwerden empfahl Hildegard den Saft des Beifuss‘.
Als Gewürz bei fettigen Fleischspeisen ist auch heute noch das Beifusskraut gebräuchlich, und hat wohl nie seine Bedeutung verloren. Spätestens zu Weihnachten taucht es in den Rezepturen für die Zubereitung der traditionellen Gans auf. Hildegard von Bingen schwor auf seine Kräfte beim Auflösen von Verstimmungen des Magens und Verdauungsproblemen. Im Falle von Schmerzen in Folge von Hautläsionen und Geschwüren hatte ein Rezept für die äusserliche Anwendung aufgeschrieben.
Bereits im vergangenen Jahrhundert hatte der Beifuss (Artemisia vulgaris) seine Bedeutung als Heilpflanze eingebüsst. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht liegt es an seiner abortiven Wirkung, die Familienplanung und Glaubensgrundsätzen zunehmend im Wege stand? Fakt ist, Beifuss (Artemisia vulgaris) kann allergische Reaktionen auslösen, weshalb er als Gewürz nicht übermässig verwendet werden sollte.
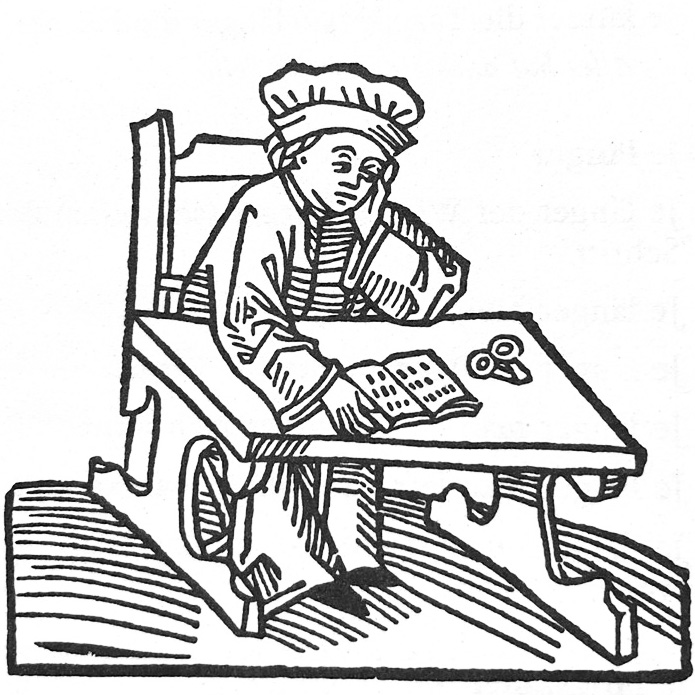
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl, Thujon, Bitter- und Gerbstoffe
Wirkung:
verdauungsfördernd
Standort:
genügsame Pflanze, karge und sandige Böden
Quellen:
Marzeller, H.; Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen, Reichl Verlag St. Goar, 2002.
Mayer, J. G., Goehl, K.; Kräuterbuch der Klostermedizin der ‚Macer Floridus‘, Nikol Verlag Hamburg, 2021.
von Bingen, H.; Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge ‚Physica‘; übersetzt von Ortrun Riha, Beuroner Kunstverlag, 2012.
Schönsperger, H.; Gart der Gesundheit, Nachdruck der Ausgabe von 1487; hansebooks, 2016.