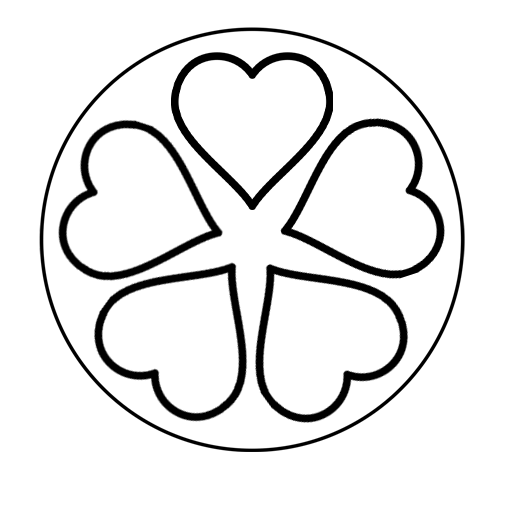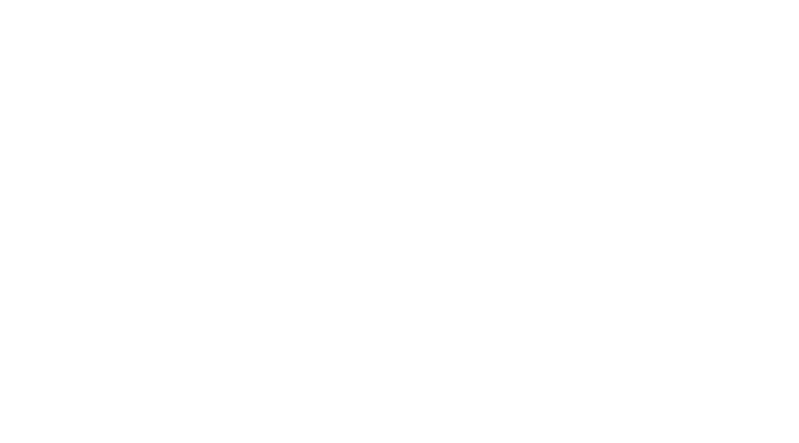Ruta graveolens
Die Wenigsten können etwas mit der alten Heilpflanze Wein-Raute (Ruta graveaolens) anfangen. Das beklagte bereits vor 140 Jahren der Kräuterpfarrer Kneipp. Seit dem hat sich nicht viel geändert. Dabei hätte doch alles so schön sein können. Im vielbeachteten Gartengedicht ‚De cultura hortum‘ schwärmt der Benediktiner Walahfrid Strabo über die Raute. Was ihn begeisterte, ist ihr aromatischer Duft und die Pflanzengestalt. Hildegard von Bingen pries ihre Wirkung als Mittel gegen Melancholie. Auch bei Leiden der Augen und Verlust der Sehkraft sollte sie ihrer Meinung nach hilfreich sein. Einig waren sich beide, dass sie bei Verdauungsstörungen gute Dienste leisten könne. Wenn überhaupt ist die Ruta (Ruta graveaolens) als Küchenkraut zum Würzen von Suppen oder für Dressings noch im Gebrauch. Als Heilpflanze hat sich ihre Spur langsam verloren, wenn auch sie im Mittelalter noch zum Inventar eines jeden Klostergartens gehörte.

Walahfrid Strabo
„Da die Raute vielfach wirkende Kraft im Innern trägt, sagt man, sie bekämpfe vor allem verborgene Gifte.“
Wahrscheinlich meinte er damit die Wirkung bei Verdauungsbeschwerden infolge verdorbener Lebensmitteln.
Beim Lesen von Strabos Zeilen kommt einigen Lesern sicherlich Umberto Eco’s Roman ‚Der Name der Rose‘ in den Sinn. Den vergifteten Mönchen in der Erzählung hätte rein hypotetisch demnach nicht einmal die Wein-Raute (Ruta graveaolens) helfen können. Selbst wenn, den betroffenen Mönchen kam in den Schilderungen jede Hilfe zu spät. Sie hatten das Irdische bereits hinter sich gelassen. Die Angst vor Giften und Vergiftungen war in vergangenen Zeiten genau so gross wie vor Dämonen und bösen Geistern. Nicht selten stellte Betroffenen sich die Frage, waren sie Opfer eines Giftanschlags geworden, oder handelte es sich schlicht um eine Lebensmittelvergiftung? Wer konnte das schon so genau sagen? Das Thema Lebensmittelsicherheit ist erst seit rund einhundert Jahren auf der Tagesordnung. Über die Haltbarkeit von Lebensmitteln entschied in jenen Tagen handwerkliches Geschick, Sorgfalt, Glück und Gottes Hilfe. Welche Folgen der Genuss verdorbenen Fischs oder Fleischs haben kann, ist den meisten aus eigener Erfahrung hinreichend bekannt. Auslöser der Übelkeit, Durchfälle bis hin zum Organversagen sind oftmals Giftstoffe, die durch den Eintrag von Erregern oder auch dem Zersetzen von Eiweissen entstehen. Dem können die Blätter der Raute (Ruta graveaolens) genauso wenig entgegenwirken wie den Dämonen, die es als Amulett getragen fernhalten soll.
„Das sollten alle closer- und ordensleut, welche keusch sein wöllen, und reinigkeit zu halten vermessentlich geloben, stets in irer speiß und drank brauchen.“
Kräuterbuch des Hieronymus Bock

Für alle, die sich fragen, wie das klösterliche Zölibat zur ertragen sei, könnte die Raute (Ruta graveaolens) eine botanische Antwort bieten. Überlieferungen nach sollte der Genuss von Wein-Raute zur Unterdrückung von „wollüstigen“ Träumen und gegen schnellen Samenfluss wirksam sein. Auch die Zeugungsfähigkeit soll sich demnach durch den Genuss der unschuldigen Pflanzen vermindern lassen. Vielfach beschrieben ist die Nutzung der Pflanze als Abortivum. Das betrifft dann eher die Folgen einer Zügellosigkeit, die sie bereits im Vorfeld einzudämmen in der Lage sein sollte. Ihren Namen Wein-Raute verdankt sie wahrscheinlich ihrer ehemaligen Verwendung als Wein-Gewürz. Heute würde niemand ausserhalb der Weihnachtszeit auf die Idee kommen, Wein zu würzen. Wer weiss, wie damals die Weine der Klöster und Abteien schmeckten? Oder war es der einfachste Weg, auf biochemischen Wege auf eine zölibatäre Lebensweise hinzuarbeiten? Immerhin gesteht die Benediktusregel den Mönchen eine Hemina Wein am Tag zu. Das entspricht in Ungefähr dem schwäbischen Viertele. Damit hätte sich rein theoretisch eine kontinuierliche Zufuhr von Wirkstoffen der Wein-Raute sicherstellen lassen. In unseren Tagen wird die Wein-Raute harmlos und ohne verschwiegene Absichten manchmal zum Abschmecken von Grappa genutzt.

Hildegard von Bingen
„Sie ist ferner im Essen roh besser und nützlicher als zerstoßen, weil ihre ganze Kraft im grünen Zustand ist.“
Gleichwohl empfahl Hildegard die Raute auch als Mittel bei Ejakulationsstörungen und zum Zügeln unrechter Begierden.
Den Beschreibungen des ‚Macer Floridus‘ diente die Wein-Raute (Ruta graveaolens) in aller erster Linie als magenstärkendes Mittel und auch bei Gichtleiden. Letzteres könnte mit der diuretischen Wirkung der Raute im Zusammenhang stehen. Wieso sie als Augenheilmittel in den alten Kräuterbüchern genannt wird, ist nicht ganz klar. Vielleicht liegt es am Inhaltsstoff Rutin einem Flavonoid mit bekanntermassen blutstillender Wirkung. Wenn Hildegard von Bingen mit schwarzen und trüben Augen kapillare Blutungen, sogenannte Glaskörperblutungen, meinte, könnte durchaus das in der Wein-Raute (Ruta graveaolens) enthaltene Rutin der rätselhafte Stoff sein, der die beschriebene Wirkung erklärt.
Die Raute ist berühmt, sie macht die Augen scharf,
Durch die Raute sieht ein Mann, was er nur sehen darf.
Doch naht er sich der Frau, wird er schwach, sie wird stark.
Er kann nicht, wie sie will; die Raute ist schon arg:
macht keusch und schärft den Blick, macht listig klug dazu.
Kochst du sie, schafft sie überall vor Flöhen sichre Ruh.
Mittelalterliche Gesundheitsregeln aus Salerno

Sie ist eine Pflanze des Mittelmeerraumes. An sonnigen und warmen Plätzen in den Klostergärten kleidet sie sich mit graugrünen Blättern, die am Ende eiförmig ausgebildet sind. Interessant anzuschauen sind die kleinen knallig gelben Blüten, mit ihrem faszinierenden Aufbau aus fünf Kronblättern, antennenartig abstehenden Staubblättern und dem beeindruckendem Blütenstempel. Bienen und andere Insekten haben ihre Freude daran und finden reichlich Futter. Im Herbst bilden sich kleine Fruchtkapseln, die sehr dekorativ aussehen und mit dem gelblich bis blaugrün changierendem Blattwerk perfekt harmonieren. Als Beetbegrenzung oder als Ergänzung in Schmuckbeeten macht sie nicht nur in Klostergärten eine gute Figur.
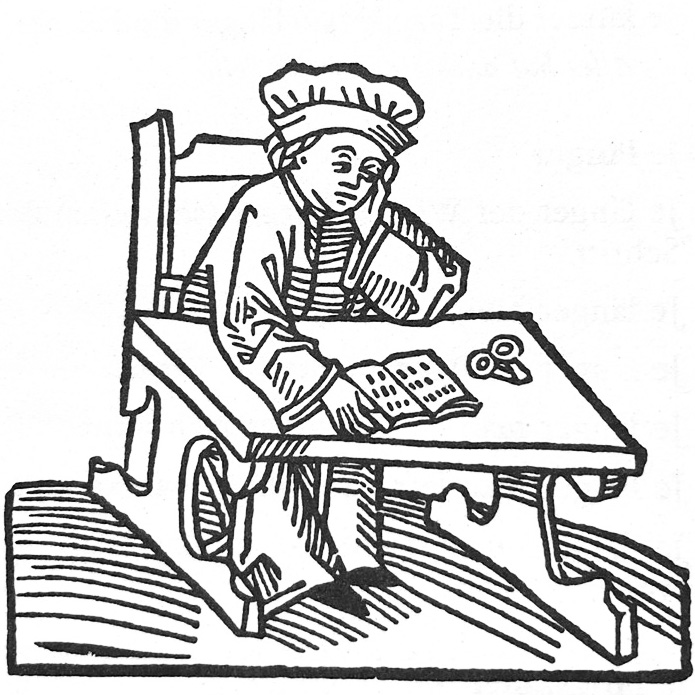
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl, Furanocumarine, Chinolin-Alkaloide, Flavonoide
Wirkung:
diuretisch, entzündungshemmend, verdauungsfördernd, krampflösend
Standort:
frische durchlässige Böden, warme und sonnige Standorte
Quellen:
Goehl, K.; Mittelalterliche Gesundheitsregeln aus Salerno, Deutscher Wissenschaftsverlag Baden-Baden, 2009.
Kneipps Haus-Apotheke; Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Hamburg, 2015
Marzeller, H.; Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen, Reichl Verlag St. Goar, 2002.
Mayer, J. G., Goehl, K.; Kräuterbuch der Klostermedizin der ‚Macer Floridus‘, Nikol Verlag Hamburg, 2021.
Regula Benedicti, Salzburger Äbtekonferenz, Beuroner Kunstverlag, 2006.
Strabo, W.; De cultura hortorum – Über den Gartenbau, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2018
von Bingen, H.; Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge ‚Physica‘; übersetzt von Ortrun Riha, Beuroner Kunstverlag, 2012.