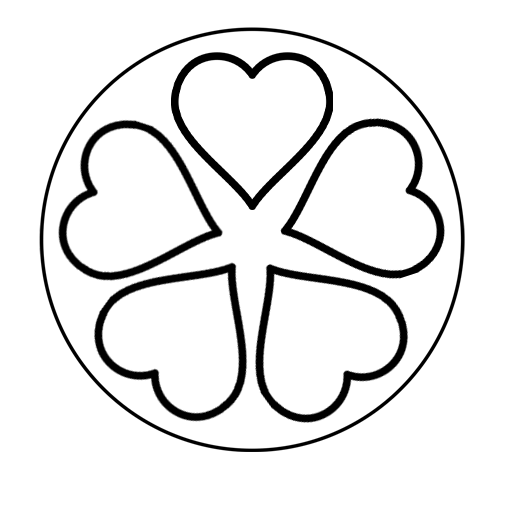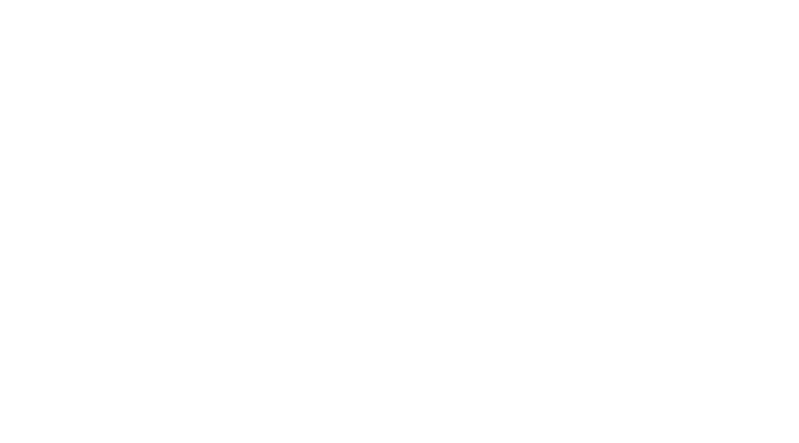Artemisia abrotanum
Das Kraut mit seinen würzig-aromatischen Blättchen hat die Menschen schon immer fasziniert. Heute begeistert vor allem die Besucher historischer Gärten der an Cola erinnernde intensive Duft die jüngeren Besucher. Wird heute die Eberraute (Artemisia abrotanum) gerne als Cola-Kraut bezeichnet, kannten sie die Generationen vor uns vor allem als Stabwurz. An senkrecht aufragenden leicht verholzenden Zweigen wachsen die fiederteiligen schmalen Blätter, die dem Dill ähneln. Selten werden die niedrigwachsenden Halbsträucher aufgrund ihres eigenwilligen Erscheinungsbildes als Gartenschmuck genutzt. Hauptsächlich verdanken wir Ihre Anwesenheit dem Aroma.
Stabwurz mit Wein und Zucker gesotten und getrunken macht einen warmen Magen, dem der erkältet ist.
Gart der Gesundheit1

Heilkraut mit zweifelhafter Wirkung
An kaum einem Kraut scheiden sich die Geister wie bei der Eberraute (Artemisia abrotanum). Die einen loben sie als Heilpflanze, die anderen als reines Gewürzkraut für den Likör. Beides waren schon immer gute Argumente, ein aromatisches Kraut wie dieses im Klostergarten anzubauen. Allerdings wird des Öfteren der Eberraute (Artemisia abrotanum) eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt, was wiederum ihren Anbau in Klostergärten rätselhaft erscheinen lassen mag. Im wohl ältesten Zeugnis der Klosterheilkunde im deutschsprachigen Raum, dem Lorscher Arzneibuch findet sich eine Rezeptur gegen Wunden im Mund und bei geschwollenem Zahnfleisch. Auch gegen Kopfschmerzen wussten die Schreiber des Lorscher Arzneibuches Rat: Reib je eine Unze Eberraute und Efeu-Gundermann mit Salz und Pfeffer, rühre es mit Wasser und Wein an und gib es zu trinken.2 Bezüglich Nebenwirkungen und Häufigkeit der Anwendungen machte der Schreiber damals noch keine Anmerkungen.
Mittelalterliche Rezeptur bei Wunden im Mund
Reibe sorgfältig frische Eberraute, vermisch sie
mit Honig, betupfe innen die schmerzenden Stellen,
und trag sie außen, wo die Schwellung ist,
auf: es heilt wunderbar!
Lorscher Arzneibuch3

Experten des Mittelalters uneins
Voll des Lobes über die Eberrraute (Artemisia abrotanum) ist der ehemalige Abt von Reichenau, bekannt durch seine Lehrgedichte auf den Gartenbau ‚De cultura hortorum‘. Einen Namen machte sich der Benediktiner mit seiner Dichtkunst, seinen Kenntnisse zur Botanik und in seiner Funktion als Erzieher des Kaisers. Noch heute werden nach seinem Vorbild Klostergärten angelegt und gepflegt. In Würdigung seines Wirkens werden bis zum jetzigen Tage im Schatten des ehemaligen Klosters Reichenau die von ihm beschriebenen 24 Nutzpflanzen, Heil- und Küchenkräuter angebaut. Die Eberraute ist auch dabei.

Walahfrid Strabo
„Zudem besitzt die Eberraute ebenso viel Kräfte wie haarfeine Blätter.“
Walafrid Strabo empfahl die Eberraute als Mittel gegen Fieber, bei Seitenstechen, bei Gicht und Gliederschmerzen.4
Hildegard von Bingen teilte Strabos Begeisterung für die Eberraute (Artemisia abrotanum) bei Weitem nicht. Wesentlich distanzierter beschrieb sie die Wirkungen der duftenden Blätter. Einig war sie sich mit dem Abt von Reichenau lediglich in der Verabreichung von Eberraute bei Gicht. Sie schrieb der Eberraute die Komplexionen warm und trocken zu. Aus ihrer Sicht war die Eberraute ein wirksames Mittel gegen Ausschlag, Krätze und Geschwüre der Haut. Zur Behandlung von Hautbeulen und Kontrakturen der Gelenke empfahl Hildegard Auflagen aus frisch zerriebenen Eberrauteblättern.

Hildegard von Bingen
„Eberraute … und ihr Geruch – … löst im Menschen Melancholie und Jähzorn aus und ermüdet sein Haupt.“
Anwendungen mit Eberraute sollten allerdings den erforderlichen Zeitraum nicht überschreiten, weil sie laut Hildegards Meinung dann mehr schaden als nützen würden.5
Würziges Fieber- und Universalmittel
Die Mehrzahl der Rezepturen mit Eberraute im ‚Gart der Gesundheit‘ dem Kräuterbuch aus dem Jahre 1487 sind Ansätze in Wein. Einerseits treiben sie Parasiten wie Würmer aus dem Leib. Andererseits waren derartige Heissgetränke an Erkältungskrankheiten Leidenden wärmstens empfohlen. Ihre trockene Wärme sollte in der Lage sein, das krankheitsverursachende Phlegma (Schleim) aufzulösen. Selbst gegen Fieber wurden Zubereitungen mit der Eberraute genutzt. Im Haus verstreute Eberraute sollte Schlangen und anderes giftiges Getier vertreiben und fernhalten können.
Die Bedeutung der Eberraute (Artemisia abrotanum) als Heilpflanze verliert sich jedoch im Laufe der Zeit. Selbst ihr Ruf als Aphrodisiakum ist scheinbar verblasst. Am hohen Thujon-Gehalt kann es nicht liegen. Thujon ist ein nervengiftiger Stoff, der auch unter dem Namen Absinthol bekannt ist. Böse Zungen behaupten, einem anderen Vertreter aus der Gattung Artimisia hätte genau das seine Karriere gesichert.
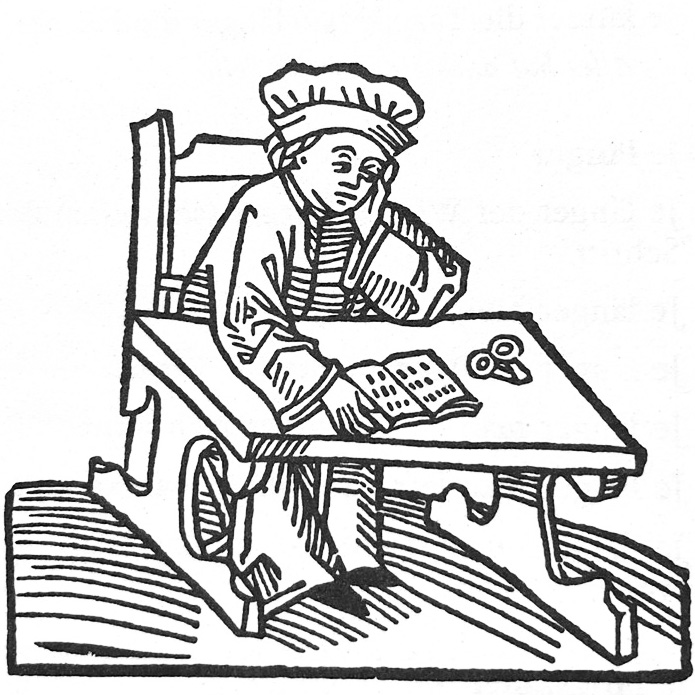
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
ätherisches Öl, Abrotanin, Absinthin, Cumarine, Humulen, Flavonoide, Gerb- und Bitterstoffe
Wirkung:
magenstärkend, galletreibend
Standort:
sonnig, trockene Böden, Rückschnitt im Frühjahr
Quellen:
- Schönsperger, H.; Gart der Gesundheit, Hanse-Verlag, Hamburg 2024. ↩︎
- Lorscher Arzneibuch – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Med.1; Curationes Buch 2, 18v, 12. Absatz, urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000003730 ↩︎
- Lorscher Arzneibuch – Staatsbibliothek Bamberg Msc.Med.1; Curationes Buch 2, 24v, 30. Absatz, urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000003730 ↩︎
- Strabo, W.; De cultura hortorum – Über den Gartenbau, Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, 2018. ↩︎
- von Bingen, Hildegard; Physica – Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkung der Dinge, Beuroner Kunstverlag, 2012. ↩︎
https://www.plus.ac.at/wp-content/uploads/2021/02/EX_FrC3BChmittelalter_im_Bodenseeraum_Walahfrid_Strabo.pdf, gelesen 20.04.2025
https://flexikon.doccheck.com/de/Absinthol, gelesen 08.05.2025