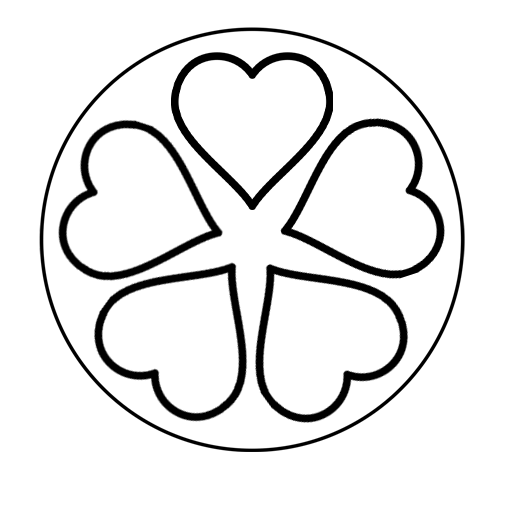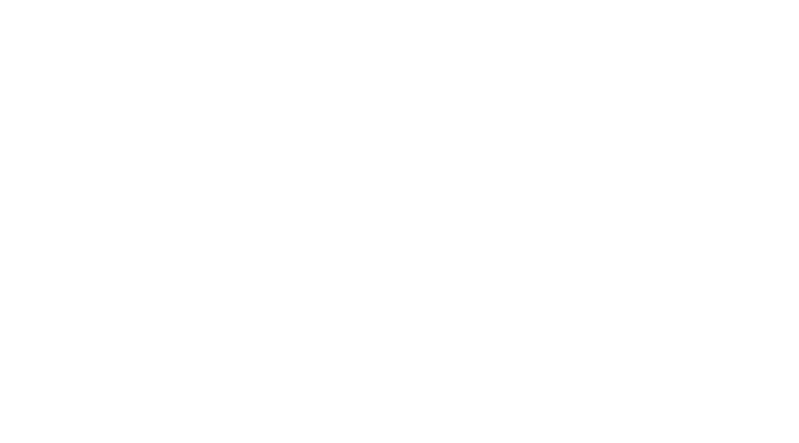Inula helenium
Erkältungen und Husten quälten die Menschen wohl schon immer. Das liegt am Lauf der Jahreszeiten und insbesondere an ihren Lebensumständen. Wer meint, die mittelalterlichen Klöster waren Horte der Gemütlichkeit, der sollte sich die Ausführungen des ehemaligen Augustinermönchs Martin Luther widmen oder das ehemalige Dormitorium des Zisterzienserstifts Zwettl anschauen. Die Nachfrage nach hustenstillenden Heilmitteln musste damals gross gewesen sein. Eines der Ältesten und zu seiner Zeit Bewährtesten ist der oft als Helenenkraut, Brust-Alant oder Darmkraut bezeichnete Echte Alant (Inula helenium).
„… dienet zur Lungensucht und wider vergiftete Luft: Gewißlich eine köstliche Arzeney!“
Westböhmisches Kräuterbuch 18. Jh

Den Römern bekannt
Wann und wie er seinen Weg in die Klostergärten fand, ist nicht überliefert. Es wird vermutet, dass der Echte Alant (Inula helenium) urspünglich aus Zentralasien stammt. Heinrich Marzeller berichtet, dass die Römer ihn bereits landwirtschaftlich anbauten und als Enula campagna bezeichneten, was sich auf das bevorzugte Anbaugebiet Kampanien westlich von Neapel bezog. Die vom römische Arzt Pedanius Dioskurides beschriebenen Heilwirkungen des Echten Alant (Inula helenium) sollten auch für die kommenden Jahrhunderte Bestand und Gültigkeit haben. Die im Sommer ausgegrabenen Wurzeln des Alants werden zerschnitten und getrocknet. Mit Honig eingenommen sollten sich Husten und Beklemmungen in der Brust lösen lassen. Abkochungen aus der Wurzel des Alants werden nicht nur diuretische sondern auch abortive Wirkungen zugeschrieben. Inwiefern letzteres für Klöster relevant war, lässt sich aus heutiger Sicht nicht beantworten. Es sei denn, man schenkt den Geschichten eines gewissen Giovanni Boccaccio Glauben.
Samt Wurzeln, Strunk und Kraut
Sonnengelb sind die Blüten der hochaufragenden Staude Alant. Sie kann Wuchshöhen bis zu zwei Metern erreichen. Ihr dunkelgrünes krautiges Blattwerk bedeckt den Boden und hält die Feuchtigkeit. Mit ihren knallgelben Blüten ist sie ein beliebter Hingucker für Bauern- und Staudengärten. Hauptsächlich sind es die fleischigen aromatischen Wurzeln, die heilkundlichen Zwecken dienten. Das ‚Macer Floridus‘ ,ein Medizinbuch aus dem 9.-10. Jahrhundert, erwähnt die Verwendung der gesamten Pflanze. So sollten die Blätter beispielsweise als Pflaster aufgelegt bei Nierenleiden hilfreich sein. Hildegard von Bingen empfahl den Alant zur Herstellung eines Heilweins zur Linderung von Halbseitenkopfschmerz und Lungenleiden.

Hildegard von Bingen
„Alant ist von warmer und trockener Natur und enthält nützliche Kräfte.“
Sie warnte vor dem übermässigem Gebrauch, weil die Stärke des Alants durchaus schaden könne.
Problematische Inhaltsstoffe
Mit der allgemeinen Zunahme von Allergien verlor der Echte Alant (Inula helenium) als Heilpflanze an Bedeutung. Schuld daran sind die in seinen Wurzeln enthaltenen Sesquiterpenlaktone. Einerseits haben diese Inhaltsstoffe antibakterielle, antifungale und im Falle des Echten Alants (Inula helenium) atemanaleptische (atmungsstimulierend) Wirkungen. Andererseits können die Sesquiterpenlaktone bei empfindlichen Menschen sensibilisierend wirken und Kontaktallergien auslösen. Obwohl der Echte Alant (Inula helenium) lange Zeit als Heilpflanze für Atemwegserkrankungen und insbesondere bei chronischem Husten galt, wird die Anwendung aufgrund des Risikos von allergischen Reaktionen nicht mehr empfohlen!
Das Geheimnis der Wurzel
Inulin ist ein Polysaccharid, das in den Wurzeln des Alants (Inula helenium) vorkommt. Umgangssprachlich wird es oft als Alantstärke bezeichnet. Für Diabetiker ist dieser süss schmeckende Stoff interessant. Weil das Inulin nicht über den Dünndarm resorbiert wird, beeinflusst es nicht den Blutzuckerspiegel. Erst im Dickdarm wird es mithilfe von Bakterien verstoffwechselt. Die dabei entstehenden kurzkettigen Fettsäuren, Oligofructoside, Oligofructose, Fructooligosaccharide gelten als Probiotika. Diese Stoffwechselprodukte können zur Verbesserung der Darmflora beitragen, da sie die Vermehrung der Bifidobakterien fördern.
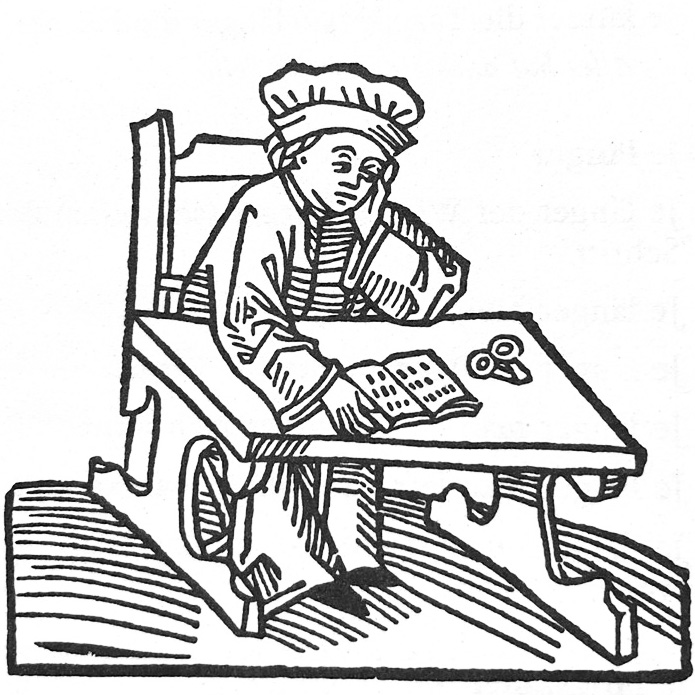
Magister omnisciens
Inhaltsstoffe:
Inulin, Helenin, Azulen, Bitterstoffe, ätherisches Öl
Wirkung:
schleimlösend, auswurffördernd
Standort:
sonniger Standort, schwere Böden, Begrenzung für sich ausbreitende Wurzeln empfohlen
„Das Pulver der Wurzeln mit Honig genossen, beschwichtigt den Husten und heilt Atemnot.“
Macer Floridus

Quellen:
Dioskurides, P.; De materia medica, Übersetzung: Julius Berendes (1902), Bearbeitung: Alexander Vögtli (1998), pharmawiki.ch
Fintelmann, V., Weiss, R. F., Kuchta, K.; Lehrbuch Phytotherapie, Karl F. Haug Verlag Stuttgart, 12. Auflage 2009.
Hänsel, R., Sticher, O.; Pharmakognosie-Phytopharmazie, 9. Auflage, Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2010.
Marzeller, H.; Geschichte und Volkskunde der deutschen Heilpflanzen, Reichl Verlag St. Goar, 2002.
Mayer, J. G., Goehl, K.; Kräuterbuch der Klostermedizin der ‚Macer Floridus‘, Nikol Verlag Hamburg, 2021.
Hildegard von Bingen; Heilsame Schöpfung – Die natürliche Wirkkraft der Dinge ‚Physica‘; übersetzt von Ortrun Riha, Beuroner Kunstverlag, 2012.
https://www.kup.at/db/phytokodex/datenblatt/Alantwurzel.html; gelesen 21.08.2025.